The Joy of Use – IT und klinische Pharmakologie
Prof. Dr. Walter E. Haefeli hat Medizin studiert, ist zwischen seiner Heimatstadt Basel und verschiedenen Universitäten in den USA gewechselt, und heute Ärztlicher Direktor der Abteilung Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Was ihn an seinem Job reizt und wo er sich mehr Unterstützung wünscht, verrät er im Interview.
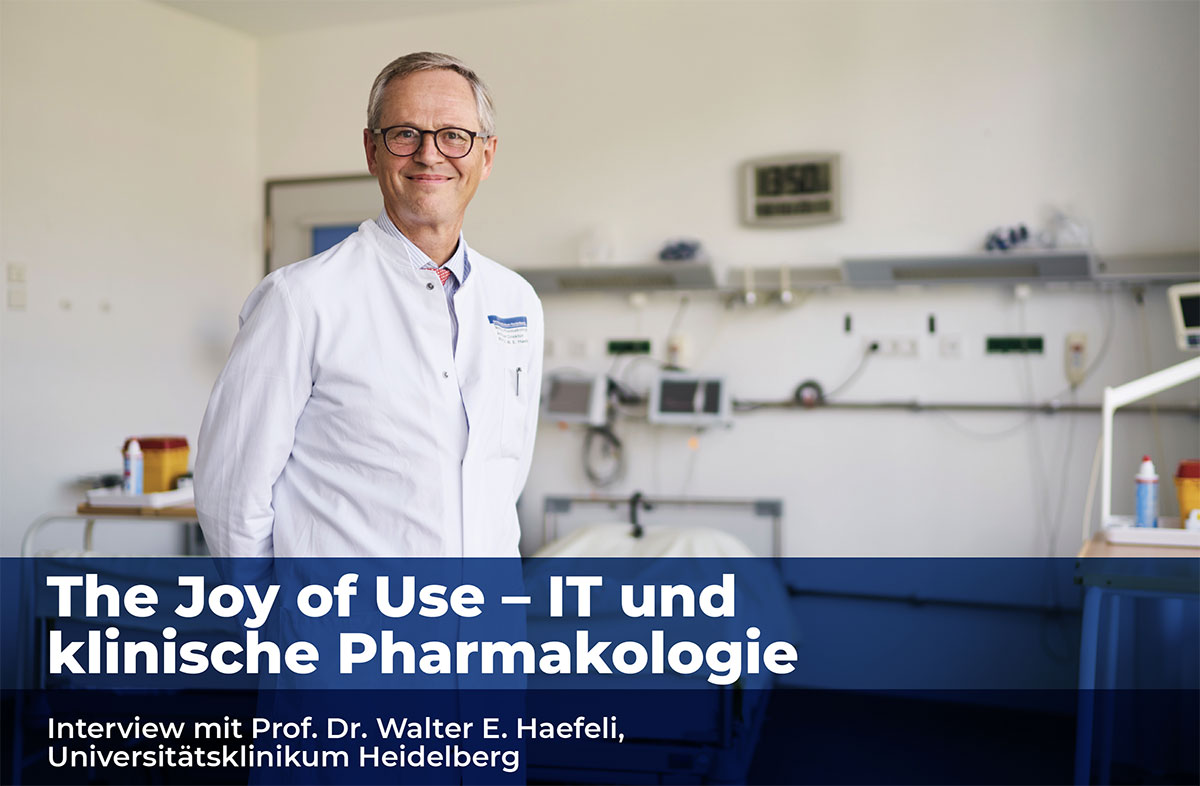
Prof. Haefeli, worin liegt für Sie die Faszination der Pharmakologie?
Prof. Dr. Walter E. Haefeli: Darin, dass nichts genau stimmt, was man zu wissen glaubt. Wir tasten uns von Grau- und Weißtönen über die Jahre zu etwas schärferen Kontrasten. Es gibt wenige Standards und die müssen immer wieder revalidiert werden. Wir werden immer besser. Wir sammeln immer mehr Information. Aber so ganz sicher ist man sich nie, was man tut; man muss also wachsam bleiben, immer genau hinschauen, sich kümmern. Gleichzeitig muss man lernen, mit der Unsicherheit umzugehen. Und man muss Wege finden, in der Unsicherheit das Bestmögliche zu machen und die gefährlichsten Dinge zu vermeiden.
Warum gibt es so viele Grautöne?
Prof. Haefeli: Wir können nicht jede Situation studieren, das geht weder zeitlich noch finanziell. Wir haben also keine sicher übertragbare Evidenz. Also müssen wir Schlüsse ziehen aus den Studien, die wir haben. Das ist ein Spiel mit Erfahrung und Wahrscheinlichkeiten und da bewegen wir uns in der Grauzone. Um den besten Ausweg zu finden, muss man sich über viele Jahre mit diesen Unschärfen beschäftigen. Dann beginnt man, die wichtigen von den weniger relevanten Variablen erfolgreich zu trennen. Das ist ärztliche Kunst.
Kann IT die Pharmakologen in ihrer Arbeit unterstützen?
Prof. Haefeli: Schön wäre es. Wenn wir heute am Computer Medikamente dosieren, steht der Heilberufler am Ende mit einem Wirrwarr aus manchmal widersprüchlichen Vorschlägen da und muss selbst entscheiden, welche Dosis er nun verordnet. Eine Hilfe ist die IT da nicht immer, sie kostet oft viel Zeit.

Was sollten IT-Systeme neben klinischen Studien noch betrachten?
Prof. Haefeli: Alles, was im Einzelfall eine genauere Prognose ermöglicht, also beispielsweise Folgeerkrankungen, die Co-Medikation und alle bisherigen Hospitalisierungsereignisse. Dazu müssten die Daten von Krankenkassen und Krankenhäusern einbezogen werden. Nur so können wir die weißen Flecken der klinischen Studien abdecken. Darüber hinaus gibt es Big Data als zusätzliche Dimension, in der man Mustererkennung machen, modellieren und simulieren kann. Damit könnten wir dem Patienten klare Alternativen vorstellen und diese anhand einer Datenlage diskutieren. So machen wir den Patienten zum Partner in der Therapie, er ist nicht mehr nur ein Leidender. Wie könnte man all das abbilden? Prof. Haefeli: Die Grundvoraussetzung ist die nachvollziehbar und einheitlich strukturierte elektronische Verordnung. Und die müsste nach den Erfordernissen der Anwender konzipiert sein. Erste Voraussetzung ist die beschriebene Integration der Alerts in den Workflow. Dann braucht es eine fehlertolerante Suchfunktion mit gleichberechtigter Suche nach Wirkstoff und Handelsnamen. Jedes siebte Medikament im Krankenhaus wird falsch geschrieben. Sie verlieren den Anwender, wenn er nicht trotzdem einen passenden Vorschlag angezeigt bekommt. Sehr wichtig ist auch die – wie ich es nenne – Joy of Use. Der Mitarbeiter muss gerne mit dem System arbeiten, es soll seine Selbstwirksamkeit erhöhen, er muss es cool finden. Seine Maxime muss sein: „Ich habe da ein komplexes Problem, aber zusammen mit dem System kann ich das in kurzer Zeit lösen. Dann habe ich eine gute Entscheidung getroffen und darauf bin ich stolz.“

Schauen wir mal in die Zukunft. Wie sieht Ihres Erachtens als Pharmakologe das deutsche Gesundheitswesen in zehn bis 15 Jahren aus?
Prof. Haefeli: Das ist jetzt mehr Hoffnung als realistische Einschätzung. Wir haben in den meisten Krankenhäusern ein CPOE implementiert. Und wenn es gut läuft, auch in den Reha-Einrichtungen sowie den Alten- und Pflegeheimen – gerade da wäre es besonders nötig. Methoden der Künstlichen Intelligenz sind in der täglichen Medizin angekommen und die Digitalisierung ist flächendeckend fortgeschritten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Gesundheitseinrichtungen einen deutlich größeren Teil des Umsatzes als bisher in diese Entwicklungen investieren. Die Dokumentationstätigkeiten sind durch gut vernetzte Systeme und optimale Datenlogistik von den Schultern der Pflege- und Heilberufe genommen. Vielleicht hat sich die Bevölkerung in den nächsten zehn bis 15 Jahren auch daran gewöhnt, dass ihre Daten dem betreuenden Team umfassend zur Verfügung gestellt werden, damit Fehler durch Unkenntnis des Patientenfalls abnehmen. Ob es einem Unternehmen in zehn Jahren gelingt, ein wirklich disruptives System zur Unterstützung bei der Medikation zu entwickeln, weiß ich nicht. Das müsste auf jeden Fall Redundanzen beheben, die wiederholte Dateneingabe eliminieren, individuelle Komplexität in rationale Maßnahmen übersetzen, multiple Warnhinweise zu einem Arzneimittel auf eine Maßnahme reduzieren und so helfen, Fehler zu vermeiden und Prozesse zu beschleunigen.